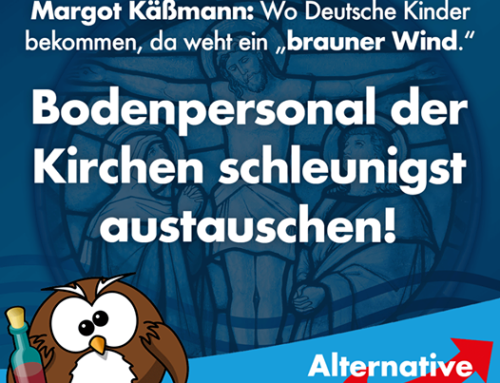13.12.2018.
Ein Beitrag von Florian Sander.
Warum es für eine bessere Welt auch weiterhin Nationalstaaten braucht.

Wer von „Klassen“ redet, der kommt um eine makrosoziologische Betrachtung der Gegenwart nicht herum: „Gibt“ es überhaupt noch Klassen beziehungsweise eine Klassengesellschaft, also eine hierarchische Differenzierung der Gesellschaft, die sich nach ökonomischen Verhältnissen richtet? Eine politisch-hierarchische Gesellschaftsdifferenzierung können wir mit dem Ende der Ständegesellschaft in Europa jedenfalls definitiv als passé betrachten.
Spricht man in den politischen und soziologischen Debatten der Gegenwart von sozialer Ungleichheit in der Gesellschaft, so ist in den meisten Fällen – in der Politik sowieso; in den Sozialwissenschaften zumindest meistens – von „sozialen Schichten“, jedoch nicht mehr von Klassen die Rede.
Damit einher geht die implizite Annahme, dass der geologisch konnotierte Begriff der Schicht zwar immer noch auf eine Hierarchie hindeutet – Ober-, Mittel- und Unterschicht; zusätzlich differenzierbar in feinere Unterteilungen wie „obere Mittelschicht“ und so weiter –, aber dass in diesem Fall mehr Durchlässigkeit, also mehr Aufstiegschancen gegeben sind als es bei Klassen der Fall ist. Folgt man dieser Annahme, so würde man damit attestieren, jedenfalls nicht mehr in einer Klassengesellschaft zu leben.
Richtet man eben diese Frage an das bundesrepublikanische Grundgesetz, so dürfte die Antwort klar sein. Mit dem Gleichheitsgrundsatz und entsprechenden Prinzipien ist zumindest theoretisch die Möglichkeit des sozialen Aufstiegs – und auch des sozialen Abstiegs – gegeben, was einen unzweifelhaft vorhandenen Unterschied zur Gesellschaft des 19. Jahrhunderts ausmacht.
Nun ist die Disziplin, die sich mit gesellschaftlichen Zuständen befasst, aber (glücklicherweise) nicht die Rechtswissenschaft, sondern die Soziologie. Und mit dieser kann man verhältnismäßig schnell zu der Erkenntnis gelangen, dass es einen zuweilen beträchtlichen Unterschied gibt zwischen rechtlicher Wunschvorstellung und sozialer Realität.
Klassen, Schichten und Milieus.
Um diese Erkenntnis zu unterfüttern, müssen wir keinen Blick auf die globale Ebene richten, wo uns ein zwischenstaatliches Äquivalent zur nationalen Klassengesellschaft bereits über die ökonomische Zentrum-Peripherie- beziehungsweise über die Industrieländer-Entwicklungsländer-Differenzierung von Staaten entgegenspringt (für einen neomarxistischen Blickwinkel auf dieses Phänomen sei hier auf die Weltsystem-Theorie nach Immanuel Wallerstein verwiesen).
Nein, es reicht ein Blick auf die Post-Agenda-2010-Bundesrepublik, um festzustellen, dass es dort, wo es ganzen Milieus der Gesellschaft an ökonomischem, sozialem, kulturellem und / oder symbolischem Kapital (Pierre Bourdieu) fehlt, sich auch soziale Aufstiegschancen arg in Grenzen halten.
Was sich – neben den oben beschriebenen rechtlichen Prämissen – zweifellos geändert hat, sind die gesellschaftlichen Kommunikationsräume. So kann man im Zuge des Prozesses funktionaler Ausdifferenzierung der Gesellschaft, welche mit dem technischen Fortschritt Hand in Hand geht, etwa feststellen, dass – nicht zuletzt über Massenmedien und Internet – die gegenseitige Beobachtbarkeit ausgebaut wurde:
Die „obere Mittelschicht“ kann die „Unterschicht“ in den Doku-Soaps des Privatfernsehens „live“ beobachten und somit schneller die Nase rümpfen, während letztere unter anderem über Google, YouTube und Facebook schneller und direkter wahrnimmt, was ihr alles so fehlt. Ob der soziale Friede dadurch stabilisiert wird, lässt sich anzweifeln.
Auch wird ein soziologisch informierter Blick auf die Gesellschaft der Gegenwart – und hierbei ist es egal, ob er von „Schichten“ oder von „Klassen“ ausgeht – nicht darauf verzichten können, eine solche vertikale Differenzierung um die horizontale nach „Milieus“ zu ergänzen. Die Tatsache, dass ein mittelständischer Unternehmer Meier einerseits und ein Gymnasialschulleiter Müller andererseits in etwa gleich viel verdienen, verwischt eben immer noch nicht die politisch zuweilen durchaus entscheidende Differenz zwischen Besitzbürger und Bildungsbürger.
Ähnlich ließen sich derartige Differenzen logischerweise auch für die „bildungsferne Schicht“ ausmachen: Sei es die Frage, ob jemand in einem Arbeitsverhältnis ist oder nicht; sei es die Frage, mit welchem kulturellen Hintergrund man es jeweils zu tun hat; sei es die Frage nach dem Geschlecht; sei es die Frage nach alten oder neuen Bundesländern oder sei es die Frage nach dem Alter (perspektivloser Jugendlicher ohne Ausbildungsplatz oder Frührentner und so weiter) – auch hier sind verschiedenste Milieus denkbar, die hinsichtlich der Frage nach sozialen Identitäten zuweilen zu höchst unterschiedlichen Antworten führen können.
Um den analytischen Pirouetten ein Ende zu setzen: Angesichts der immer weiter auseinanderklaffenden Schere zwischen Arm und Reich, angesichts fehlender sozialer Durchlässigkeit beziehungsweise fehlender Aufstiegschancen weiter Teile der Bevölkerung und auch angesichts der übrigen Entwicklungen, die als Folge der Agenda 2010 und der Hartz-Reformen anzusehen sind, ist es auch für die Bundesrepublik keineswegs verkehrt, nicht lediglich von „Schichten“, sondern von „Klassen“ zu sprechen – was wiederum den Begriff der Klassengesellschaft legitimiert.
Man wird jedoch ein politisch maßgebliches Problem ausblenden, wenn man ignoriert, welche Komponente Milieubildung und Individualisierung der Klassengesellschaft hinzugefügt haben.
Denn die Frage, ob eine Klasse auch eine „politische Einheit“ und somit ein revolutionäres Subjekt sein kann, entscheidet sich nicht über soziologische Diagnosen, sondern über die Herstellung einer entsprechenden kollektiven Identität, also danach, ob sie sich selbst als eine solche Einheit, als ein solches Subjekt zu betrachten vermag – oder anders gesagt, ob ein Klassenbewusstsein vorhanden ist.
Fehlendes Klassenbewusstsein.
Eben diesem beziehungsweise seiner Entstehung haben Individualisierung und Milieubildung im postmodernen Zeitalter große Steine in den Weg gelegt. Weite Teile sozial benachteiligter Milieus in Deutschland rezipieren sich selbst weder als „ausgebeutet“ noch als „unterdrückt“, selbst wenn die sozialen Verhältnisse über die Gründe für ihre sozialstrukturelle Positionierung eigentlich eine mehr als klare Sprache sprechen. Nicht selten rümpft der berufstätige Arbeiter lieber über den Hartz-IV-Empfänger die Nase, der Frührentner schimpft über die ungebildete Jugend von heute, „Ossis“ schimpfen über „Wessis“ und umgekehrt und für die Heranwachsende ohne Schulabschluss ist der Instagram-Account zuweilen reizvoller als die nächste Demo für soziale Gerechtigkeit.
Bildungsferne Jugendliche mit Migrationshintergrund suchen sich – mindestens in Frankreich – neue kollektive Identitäten in der Religion; ansonsten aber – und dies gilt auch für soziale Brennpunkte in Deutschland – in mitunter delinquenten Gang-Strukturen. Vom Import und von der Schaffung eines neuen Unterschicht-Milieus im Rahmen der Flüchtlingspolitik ganz zu schweigen.
Derweil kümmern sich nicht wenige Linke lieber um das Gendern akademischer Texte (Sternchen oder Unterstrich? Man denke sich an dieser Stelle einen hippen feministischen Hashtag hinzu!), während ökonomische Fragen im wahrsten Sinne des Wortes links liegen gelassen werden. Postmoderne Entwicklungen, Parallelgesellschaften, Grenzöffnungen, Individualisierung und Milieubildung wirken in zuverlässigster Form destruktiv auf die Herstellbarkeit eines Klassenbewusstseins. Ein verschwörungstheoretischer Schelm, wer meint, all dies könne eventuell in eben dieser Weise von neoliberaler Seite aus beabsichtigt sein.
Es braucht nicht allzu viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass die Situation auf globaler Ebene nicht besser oder weniger komplex wird. Mindestens die Gesellschaften Europas und Nordamerikas haben mittlerweile zuverlässige Instrumente gefunden, jede Form von revolutionärer Bestrebung, die sich auf einen grundlegenden Wandel globaler Verhältnisse richtet, über linksliberale organisierte Gewissensberuhigungen zu kanalisieren.
So ein „Flashmob für die Dritte Welt“ ist schließlich schnell organisiert, macht „Fun“ und liefert nebenbei noch nette Bilder für den Instagram-Account, der allen zeigt, wie engagiert man ist und dem ureigenen Digitalnarzissmus der Generation Y Genüge tut. Andere Wege führen über bequeme Likes auf Facebook und das Teilen von Twitter-Posts hin zum Engagement bei lokalen NGO-Stammtischen.
Um nicht missverstanden zu werden: All dies muss nicht falsch sein. Nur halten sich die Folgen für die den Grundstein für die Problematik legenden globalen Wirtschaftsstrukturen eben in Grenzen. Zugleich wird das Bedürfnis, etwas zu verändern, über „Ventilsitten“ (Alfred Vierkandt) wie diese wirkungsvoll kanalisiert, indem der Eindruck entsteht, im Rahmen der „realpolitisch“ vorhandenen Möglichkeiten seinen Teil beigetragen zu haben.
Alles andere ist dann eben Sache „der Politiker“. Die Grünen-MdB aus dem Wahlkreis kommt ja schließlich auch regelmäßig zum NGO-Stammtisch. Und hört immer gut zu. Nicht selten auch mit betroffenem Gesichtsausdruck.
Polemiken wie diese bergen in sich das Risiko, abermals falsch verstanden zu werden: Weder das Ziel eines Klassenkampfes noch das Ziel, das diesem vorausgehen muss, also die Herstellung eines Klassenbewusstseins, sind deswegen falsch. Doch wer meint, angesichts der oben beschriebenen Entwicklungen könne dies als kollektive Identität ausreichen, erliegt einem folgeschweren Irrtum, der den Neoliberalen in die Hände spielt.
Es geht nicht ohne die Nation.
Die Nation beziehungsweise der Nationalstaat bilden kollektive Identitäten, die auch heute noch – klassenübergreifend – eine beträchtliche Wirkungsmacht entfalten: Die Nation, indem sie nach wie vor im Lebensgefühl der meisten Menschen verankert ist (ob sie es wollen oder nicht); der Nationalstaat, indem er – vor allem über Souveränität, soziale Rechte und Wohlfahrtsstaatlichkeit – Strukturen bietet, die geeignet sind, den „Global Players“ politisch wirkungsvoll etwas entgegenzusetzen. Sie verknüpfen (welt-)politische Handlungsfähigkeit mit kollektiver Identität; sie schaffen einen gesellschaftlich anerkannten politischen Handlungsrahmen – und ziehen genau daraus ihre Stärke und Legitimation.
Dies bedeutet freilich nicht, dass Nationalstaaten als solche immer und jederzeit eine konstruktive Rolle in der Weltpolitik oder Weltwirtschaft einnehmen – hier gilt es, politikwissenschaftlich gesprochen, die grundlegende politische Struktur („polity“) vom politischen Output („policy“), also etwa der konkreten Regierungspolitik, zu differenzieren. Entscheidend jedoch ist die Struktur, nicht die Regierungspolitik: Man ist eben „Deutscher“, nicht „Merkels Untertan“.
Wer glaubt, Nationalstaatlichkeit als solche würde Ignoranz gegenüber den globalen Verhältnissen stärken und nur weitere Barrieren zwischen den Völkern errichten, vergisst, dass solidarisches Handeln nur möglich ist, wenn man einerseits seiner eigenen Position, seiner Identität und seiner Handlungsfähigkeit gewiss ist, und wenn man andererseits den Adressaten seiner Solidarität kennt und identifizieren kann (nicht umsonst haben „Identität“ und „Identifikation“ den gleichen Wortstamm).
Zwei Bedingungen, die in einem grenzenlosen, liberalisierten, ökonomisierten und radikal individualisierten globalistischen Brei nicht mehr erfüllbar wären. Revolutionäre Kraft entfaltet sich – und dies zeigen nicht zuletzt die anti-imperialistischen Bestrebungen zahlreicher Staaten Lateinamerikas in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts plastisch auf – eben immer im Zusammenwirken mit einer nationalen Identifikation, nicht aber über die Ablehnung einer solchen. Klassenkampf und der Kampf um nationale Selbstbestimmung sind zwei Seiten einer Medaille.
Ein Nationalstaat ist imstande, das zu tun, was der postmodernisierten, individualisierten und sozial zersplitterten Klasse nicht möglich ist: Für einen Wandel globaler Strukturen zu kämpfen. Es versteht sich natürlich, dass es hierfür zuvor zwingend den Wandel politischer Verhältnisse innerhalb desselben braucht – hier gewinnt die Komponente des Klassenkampfes und des Klassenbewusstseins an entscheidender Relevanz.
Beides wird jedoch ergebnislos verpuffen, wenn der Rahmen, wenn die Struktur fehlt, in der die daraus resultierende gestalterische Kraft politisch zur Geltung gebracht werden kann. Mit einem zahnlosen Tiger ist niemandem geholfen – außer jenen, denen es eben eigentlich um etwas ganz anderes geht.
Zum Autor : Florian Sander ist Dozent für Soziologie, Sozialpsychologie und Politikwissenschaft sowie Verhaltenstrainer an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW, der in Nordrhein-Westfalen unter anderem die Polizeiausbildung obliegt.

Zugleich ist er Doktorand im Fach Soziologie an der Bielefeld Graduate School in History and Sociology der Uni Bielefeld.